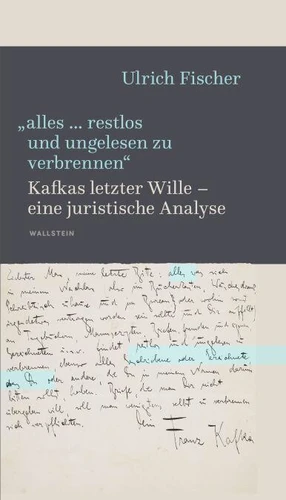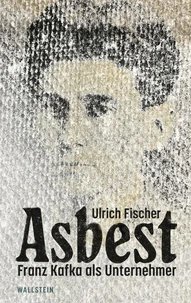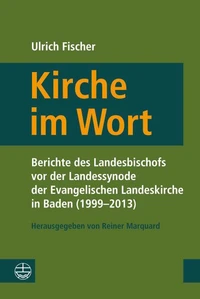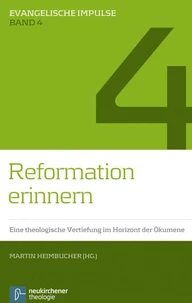»alles … restlos und ungelesen zu verbrennen«. Kafkas letzter Wille – eine juristische Analyse
Par :Formats :
Disponible dans votre compte client Decitre ou Furet du Nord dès validation de votre commande. Le format PDF est :
- Compatible avec une lecture sur My Vivlio (smartphone, tablette, ordinateur)
- Compatible avec une lecture sur liseuses Vivlio
- Pour les liseuses autres que Vivlio, vous devez utiliser le logiciel Adobe Digital Edition. Non compatible avec la lecture sur les liseuses Kindle, Remarkable et Sony
 , qui est-ce ?
, qui est-ce ?Notre partenaire de plateforme de lecture numérique où vous retrouverez l'ensemble de vos ebooks gratuitement
Pour en savoir plus sur nos ebooks, consultez notre aide en ligne ici
- Nombre de pages112
- FormatPDF
- ISBN978-3-8353-8590-0
- EAN9783835385900
- Date de parution24/07/2024
- Protection num.Digital Watermarking
- Taille3 Mo
- Infos supplémentairespdf
- ÉditeurWallstein
Résumé
Für die Literatur ein Glücksfall! War Max Brods Missachtung von Kafkas Notiz juristisch ein Fehler?
Als Franz Kafka am 3. Juni 1924 starb, hatte er einen großen Teil seiner Papiere bereits selbst vernichtet, nur wenig war zu Lebzeiten veröffentlicht worden. Kafkas Freund, der Prager Schriftsteller Max Brod, fand zwei schriftliche Verfügungen Kafkas vor, die ihn aufforderten, den bei Kafkas Tode noch vorhandenen literarischen Nachlass einschließlich aller Briefe nicht nur nicht zu lesen und zu veröffentlichen, sondern unwiederbringlich zu vernichten.
Ulrich Fischer analysiert auf der Basis der damals geltenden Rechtslage die Rechtsqualität und Rechtswirkungen dieser Verfügungen und konfrontiert sie mit dem Handeln Max Brods, der sich bekanntlich nicht an die Anweisung des Freundes gehalten hat.
Die Rettung des Werks für die Weltliteratur war nicht nur moralisch, sondern - wie detailliert beschrieben - auch juristisch gerechtfertigt.
Das verändert den Blick auf Kafkas angebliches Testament und Brods Handeln, wie es bisher in der Forschung diskutiert wurde.
Das verändert den Blick auf Kafkas angebliches Testament und Brods Handeln, wie es bisher in der Forschung diskutiert wurde.
Für die Literatur ein Glücksfall! War Max Brods Missachtung von Kafkas Notiz juristisch ein Fehler?
Als Franz Kafka am 3. Juni 1924 starb, hatte er einen großen Teil seiner Papiere bereits selbst vernichtet, nur wenig war zu Lebzeiten veröffentlicht worden. Kafkas Freund, der Prager Schriftsteller Max Brod, fand zwei schriftliche Verfügungen Kafkas vor, die ihn aufforderten, den bei Kafkas Tode noch vorhandenen literarischen Nachlass einschließlich aller Briefe nicht nur nicht zu lesen und zu veröffentlichen, sondern unwiederbringlich zu vernichten.
Ulrich Fischer analysiert auf der Basis der damals geltenden Rechtslage die Rechtsqualität und Rechtswirkungen dieser Verfügungen und konfrontiert sie mit dem Handeln Max Brods, der sich bekanntlich nicht an die Anweisung des Freundes gehalten hat.
Die Rettung des Werks für die Weltliteratur war nicht nur moralisch, sondern - wie detailliert beschrieben - auch juristisch gerechtfertigt.
Das verändert den Blick auf Kafkas angebliches Testament und Brods Handeln, wie es bisher in der Forschung diskutiert wurde.
Das verändert den Blick auf Kafkas angebliches Testament und Brods Handeln, wie es bisher in der Forschung diskutiert wurde.